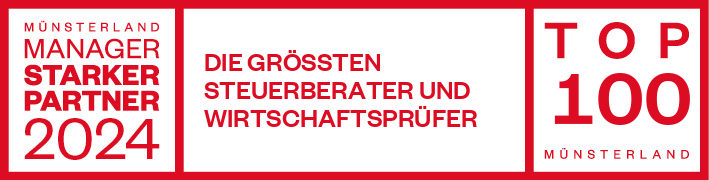Zweitwohnungsteuer: Befreiung bei unentgeltlicher Überlassung?
Wenn ein Wohnungseigentümer eine Wohnung ganzjährig oder zumindest für einen gewissen Zeitraum an einen Dritten, beispielsweise Sohn oder Tochter, unentgeltlich überlässt, verlangen viele Gemeinden dennoch eine Zweitwohnungsteuer. Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein entschieden: Ein Eigentümer oder Wohnungserbbauberechtigter kann bei Überlassung einer Wohnung an Dritte zur Zweitwohnungsteuer herangezogen werden, soweit er die Wohnung weiterhin hält und sich der Verfügungsmacht über sie nicht begibt. Auf die Hintergründe für die unentgeltliche Überlassung der Wohnung kommt es dabei nicht an. Etwas anderes gilt aber, wenn er sich der Verfügungsmacht begibt (Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.1.2025, Az. 6 LB 3/24).
Der Mutter gehört ein Reihenhaus, das sie ihrem Sohn unentgeltlich überlassen hat. Ein schriftlicher Überlassungsvertrag existiert nicht. Die Mutter wohnt in einem anderen Ort. Die Gemeinde, in der sich das Reihenhaus befindet, setzte gegenüber der Mutter eine Zweitwohnungsteuer fest. Hiergegen erhob diese Widerspruch. Zur Begründung verwies sie darauf, dass die Wohnung von ihrem Sohn, der seinen Lebensunterhalt nicht eigenständig bestreiten könne, genutzt werde. Die Nutzung gelte befristet, zunächst, solange ihr Sohn nicht in der Lage sei, seinen Lebensunterhalt eigenständig zu bestreiten. Sie selbst könne die Wohnung daher nicht nutzen und habe durch diese auch keine finanziellen Vorteile. Das Gericht pflichtete ihr bei; eine Zweitwohnungsteuer durfte nicht festgesetzt werden.
Begründung: Bei einer unentgeltlichen Nutzungsüberlassung liegt eine Verfügungsbefugnis des Eigentümers bzw. Überlassenden dann nicht mehr vor, wenn es sich um ein Rechtsverhältnis handelt, das den Anspruch auf Herausgabe beschränkt. Dies kann bei einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Leihvertrag (§ 598 BGB), in dem die Geltung der mietrechtlichen Kündigungsvorschriften der §§ 573 ff. BGB vereinbart wurde, der Fall sein oder dann, wenn der Verleiher im Einvernehmen mit dem Entleiher eine Zweckbestimmung getroffen hat und die entliehene Wohnung daher nur nach Maßgabe von § 604 Abs. 2 BGB zurückfordern kann. Vorliegend kann angenommen werden, dass die Mutter ihrem Sohn zunächst nur im Rahmen der familiären Beziehung Wohnraum verschaffen wollte, ohne sich über die rechtliche Konstruktion dieser Nutzungsüberlassung Gedanken zu machen. Entsprechend fehlt es zwar an einer ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung zwischen der Mutter und ihrem Sohn. Gleichwohl ist aufgrund der Art der hier in Rede stehenden Gefälligkeit davon auszugehen, dass die Mutter und ihr Sohn konkludent einen Leihvertrag geschlossen haben und nicht nur ein Gefälligkeitsverhältnis ohne rechtsgeschäftlichen Charakter vorliegt.
Alle Angaben ohne Gewähr.