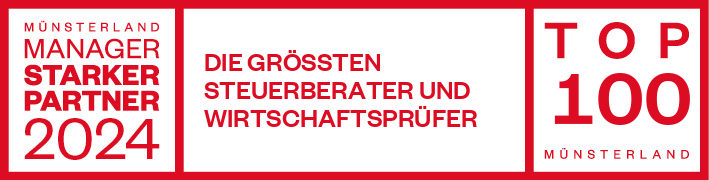Viele GmbH-Gesellschafter sind über ihre Gesellschafterstellung hinaus zusätzlich im Rahmen eines Einzelunternehmens tätig und erbringen auch Leistungen an ihre eigene GmbH. Wenn ein solcher Gesellschafter rund um den Jahreswechsel Rechnungen an seine GmbH schreibt, ist zu entscheiden, ob er die entsprechenden Erträge bereits bei Rechnungstellung oder erst bei Vereinnahmung versteuern muss - vorausgesetzt, er selbst ermittelt seinen Gewinn per Einnahmen-Überschussrechnung. Bei beherrschenden Gesellschaftern ist die Antwort eindeutig: Die Versteuerung muss grundsätzlich im Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung, also regelmäßig bereits bei Rechnungstellung, erfolgen. Das ist die so genannte Zuflussfiktion. Denn ein beherrschender Gesellschafter hat es regelmäßig selbst in der Hand, sich geschuldete Beträge auszahlen zu lassen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Anspruch eindeutig, unbestritten und fällig ist und sich gegen eine zahlungsfähige Gesellschaft richtet.
» mehrAußergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG sind unter Anrechnung einer zumutbaren Eigenbelastung steuerlich abzugsfähig. Voraussetzung für den Abzug ist aber, dass die Aufwendungen zwangsläufig entstehen, weil sich der Steuerpflichtige ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann (§ 33 Abs. 2 EStG). Nach Ansicht des Finanzgerichts München sind Aufwendungen, die ein Neffe für die krankheitsbedingte Unterbringung einer vermögenden Tante in einem Pflegeheim übernimmt, aber nicht als außergewöhnliche Belastungen abziehbar. Es liegen auch dann keine sittlichen Gründe für die Kostenübernahme vor, wenn die Tante die Eltern des Neffen lange Jahre gepflegt und versorgt hatte (FG München, Urteil vom 25.8.2022, 11 K 812/22).
» mehrÜberlässt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern verbilligt oder unentgeltlich Vermögensbeteiligungen in Form von Kapitalbeteiligungen oder Darlehensforderungen, ist der geldwerte Vorteil in bestimmter Höhe steuerfrei. Seit dem 1.4.2009 betrug der Steuerfreibetrag zunächst 360 Euro (§ 3 Nr. 39 EStG). Zum 1.7.2021 wurde der Steuerfreibetrag auf 1.440 Euro angehoben (§ 3 Nr. 39 EStG, geändert durch das "Fondsstandortgesetz"). Ab dem 1.1.2024 wird der Steuerfreibetrag für Vermögensbeteiligungen auf 2.000 Euro pro Kalenderjahr erhöht (§ 3 Nr. 39 EStG, geändert durch das "Zukunftsfinanzierungsgesetz").
» mehrEin Vermieter, der hohe Mietausfälle zu beklagen hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen teilweisen Erlass der Grundsteuer erlangen. Wichtig ist, dass der Steuerschuldner die Minderung des normalen Rohertrags nicht zu vertreten hat. Diesbezüglich hat das Verwaltungsgericht Koblenz entschieden, dass der Eigentümer einer gewerblichen Immobilie keinen Anspruch auf einen teilweisen Erlass der Grundsteuer hat, wenn er nicht genügend Anstrengungen unternommen hat, um die Immobilie zu vermieten bzw. auszulasten (Urteil vom 17.10. 2023, 5 K 350/23.KO).
» mehrZur Abmilderung der hohen Energiekosten wurde Gas- und Fernwärmekunden im Dezember 2022 eine einmalige Soforthilfe gewährt, indem diese von ihren Voraus- oder Abschlagszahlungen für den Monat Dezember 2022 freigestellt wurden. Als "sozialer Ausgleich" sollten diese Hilfen - im Jahre 2023 - versteuert werden. Auf die Besteuerung der Dezemberhilfe für die hohen für Kosten für Erdgas soll nun aber verzichtet werden. Die Regelungen werden mit dem "Kreditzweitmarktförderungsgesetz" ersatzlos gestrichen.
» mehrZum 1.7.2023 sind die Beitragssätze der gesetzlichen Pflegeversicherung neu geregelt werden. So wurde der allgemeine Beitragssatz um 0,35 Prozentpunkte angehoben und beträgt jetzt 3,40 Prozent. Zudem wurde der Beitragszuschlag für Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr um 0,25 Prozentpunkte auf 0,60 Prozent angehoben. Vor allem aber gibt es einen Beitragsabschlag, denn Eltern mit mehr als einem Kind sollen entlastet werden. Für die Berücksichtigung der Abschläge muss die Anzahl der Kinder unter 25 Jahren gegenüber der beitragsabführenden Stelle, das sind insbesondere die Arbeitgeber, nachgewiesen sein, es sei denn, diesen sind die Angaben bereits bekannt. Bei Selbstzahlern ist der Nachweis gegenüber der Pflegekasse zu führen (§ 55 Abs. 3a ff. SGB XI).
» mehrIm Bereich der Körperschaft- und Gewerbesteuer sind häufig so genannte Organschaften erwünscht. Dabei wird eine Tochtergesellschaft, die Organgesellschaft, in das Mutterunterunternehmen, den Organträger, in steuerlicher Hinsicht eingegliedert. Der Vorteil einer solchen Organschaft liegt darin, dass im Ergebnis mehrere Gesellschaften als einziges Steuersubjekt behandelt werden und Verluste im Organkreis ausgeglichen werden können. Während Organschaften im Bereich der Umsatzsteuer bereits durch die tatsächlichen Verhältnisse, das heißt durch die finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung entstehen können, bedarf es für ertragsteuerliche Zwecke neben einer finanziellen Eingliederung auch eines Gewinn- bzw. Ergebnisabführungsvertrages. Der Gewinnabführungsvertrag muss auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und während seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt werden.
» mehrWird eine Direktversicherung in einer Summe ausgezahlt, ist die Kapitalabfindung bei den sonstigen Einkünften in voller Höhe zu versteuern, falls die Beiträge bei Einzahlung steuerfrei waren (§ 22 Nr. 5 EStG). Es kommt nicht einmal die so genannte Fünftel-Regelung zum Tragen, die wenigstens zu einer geringen Minderung des Steuersatzes führen würde - zumindest gilt dies, wenn bereits in der ursprünglichen Versorgungsregelung ein Kapitalwahlrecht enthalten ist. Bereits im Jahre 2021 hat das Finanzgericht Münster die volle Besteuerung der Einmalzahlung aus einer Direktversicherung als verfassungsgemäß angesehen (Gerichtsbescheid vom 29.10.2020, 15 K 1271/16 E). Kürzlich hat das Finanzgericht Münster seine Rechtsprechung bestätigt: Bei der Auszahlung einer Direktversicherung im Wege der Kapitalabfindung kommt die Anwendung der Tarifermäßigung nach § 34 Abs. 1 EStG ("Fünftel-Regelung") nicht in Betracht. Das gilt jedenfalls bei vorheriger Vereinbarung eines Kapitalwahlrechts. Damit sind Kapitalabfindungen in voller Höhe ohne jegliche Ermäßigung zu versteuern (FG Münster, Urteil vom 24.10.2023, 1 K 1990/22 E). Die Klägerin hatte mit ihrem damaligen Arbeitgeber im Jahr 2005 die Umwandlung eines Teils ihres Gehalts in Beiträge zu einer Direktversicherung nach dem BetrAVG vereinbart. Die Gehaltsumwandlung sollte nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei sein. Der Arbeitgeber schloss daraufhin für die Klägerin eine solche Versicherung mit einer Beitragszahlungsdauer von 14 Jahren ab. Danach sollte an die Klägerin eine lebenslängliche monatliche Rente gezahlt werden oder auf Antrag eine einmalige Kapitalabfindung erfolgen. Im Streitjahr 2019 übte die Klägerin das Kapitalwahlrecht aus und erhielt ca. 44.500 Euro ausbezahlt. Diesen Betrag behandelte das Finanzamt als steuerpflichtige Rente nach § 22 Nr. 5 EStG und besteuerte ihn mit dem regulären Steuersatz. Die Klägerin beantragte dagegen die Anwendung der Fünftel-Regelung, da der Gesetzeswortlaut von § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG erfüllt sei. Die Kapitalabfindung sei in einer Summe ausbezahlt worden, so dass die erforderliche Zusammenballung von Einkünften in einem Veranlagungszeitraum vorgelegen habe. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. Die Kapitalauszahlung sei nicht ermäßigt zu besteuern.
» mehrBei einer doppelten Haushaltsführung im Inland werden die Kosten der Zweitwohnung mit maximal 1.000 Euro pro Monat steuerlich anerkannt. Dies gilt seit 2014. Bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland gilt die 1.000 Euro-Grenze zwar nicht, doch die Finanzverwaltung will lediglich die ortsübliche Durchschnittsmiete für eine 60 qm große Wohnung anerkennen (BMF-Schreiben vom 25.11.2020, BStBl 2020 I S. 1228, Rz 112). Die Finanzverwaltung nimmt also eine gewisse Typisierung vor. Dabei beruft sie sich unter anderem auf ein BFH-Urteil vom 9.8.2007 (VI R 10/06, BStBl 2007 II S. 820), das allerdings für Inlandsfälle zur alten Rechtslage ergangen ist, die bis 2013 galt.
» mehrArbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzgeld, wenn sie im Inland beschäftigt waren und bei einem Insolvenzereignis für die vorausgegangenen drei Monate des Arbeitsverhältnisses noch Ansprüche auf Arbeitsentgelt haben. Arbeitgeber müssen durch eine monatliche Umlage die Mittel für die Zahlung des Insolvenzgeldes aufbringen. Arbeitgeber der öffentlichen Hand sowie Privathaushalte sind von der Zahlung der Umlage ausgenommen. Der Umlagesatz für das Kalenderjahr 2024 wurde durch Rechtsverordnung auf 0,06 Prozent festgesetzt und bleibt damit gegenüber dem Jahr 2023 unverändert.
» mehr