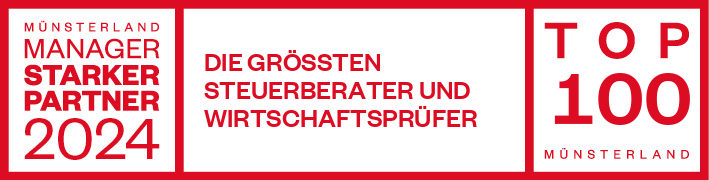Bei der Berechnung der monatlichen Lohnsteuer für Arbeitnehmer ergeben sich zum 1. Januar 2026 einige wichtige Änderungen. Das Bundesfinanzministerium hat dazu nun Stellung bezogen (BMF-Schreiben vom 3.6.2025, BStBl 2025 I S. 1454; BMF-Schreiben vom 14.8.2025, IV C 5 - S 2367/00012/004/033). Die wesentlichen Punkte, die sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer von Bedeutung sind, werden nachfolgend kurz vorgestellt.
» mehrEin Steuerpflichtiger hat im Regelfall keinen Anspruch auf Preisgabe einer anonym beim Finanzamt eingegangenen Anzeige, die ihm steuerliches Fehlverhalten vorwirft. Auch der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch vermittelt insoweit keine weitergehenden Rechte. Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs selbst dann, wenn die Anzeige nicht zu einem steuerlichen Mehrergebnis führt (BFH-Urteil vom 15.7.2025, IX R 25/24). Der Sachverhalt: Das Finanzamt nahm eine anonyme Anzeige zum Anlass, um bei einem Gastronomiebetrieb (eine Personenhandelsgesellschaft) eine Kassen-Nachschau durchzuführen. Diese führte nicht zu steuerlichen Nachforderungen und schon gar nicht zu steuerstraf- oder ordnungsrechtlichen Vorwürfen. Die zu Unrecht bezichtigte Gesellschaft beantragte daher Einsicht in ihre Steuerakten und begehrte eine Auskunft über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO. So wollte sie Kenntnis vom Inhalt der Anzeige erhalten, um eventuell Rückschlüsse auf die Person des Anzeigeerstatters ziehen zu können. Das Finanzamt lehnte die Anträge ab. Klage und Revision hatten keinen Erfolg.
» mehrMit dem "Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus" wurde eine befristete Sonderabschreibung nach § 7b EStG eingeführt. Mit dem "Wachstumschancengesetz" wurden die Förderbedingungen etwas verbessert. Die Regelung ermöglicht für vier Jahre eine Abschreibung in Höhe von 5 Prozent der Baukosten, wenn durch Baumaßnahmen neue, bisher nicht vorhandene Wohnungen hergestellt werden und diese im Anschluss für mindestens zehn Jahre vermietet werden. Diese Sonderabschreibung kann zusätzlich zur regulären Abschreibung nach § 7 Abs. 4 EStG steuermindernd berücksichtigt werden. Dabei sind verschiedene Anwendungszeitpunkte zu beachten (Bauantrag oder Bauanzeige zwischen dem 1.9.2018 und dem 31.12.2021; Bauantrag oder Bauanzeige zwischen dem 1.1.2023 und dem 30.9.2029).
» mehrSeit dem 1. Januar 2025 besteht eine Pflicht zur Ausstellung von elektronischen Rechnungen (E-Rechnungen) zwischen inländischen Unternehmern. Aufgrund von Übergangsregelungen muss zwar nicht schon jetzt jeder Unternehmer verpflichtend E-Rechnungen erteilen. Allerdings müssen inländische Unternehmer trotz der Übergangsfristen seit 1. Januar 2025 in der Lage sein, E-Rechnungen nach den neuen Vorgaben empfangen und verarbeiten zu können. Empfangene E-Rechnungen sind im Übrigen nicht nur inhaltlich zu prüfen. Vielmehr müssen E-Rechnungen auch technisch geprüft ("validiert") werden. Kürzlich hat das Bundesfinanzfinanzministerium in einem umfassenden Schreiben zur Validierung von E-Rechnungen Stellung genommen (BMF-Schreiben vom 15.10.2025, III C 2 - S 7287-a/00019/007/243). Danach gilt unter anderem:
» mehrSteuerbescheide gelten grundsätzlich vier Tage nach der Aufgabe zur Post als bekanntgegeben. Das ist die so genannte Bekanntgabe- bzw. Zugangsfiktion des § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO. Bis einschließlich 2024 galt eine Drei-Tages-Frist. Der Tag der Bekanntgabe ist wichtig, da die Einspruchsfrist von einem Monat erst ab der tatsächlichen Bekanntgabe läuft. Fällt der letzte Tag der Vier-Tages-Frist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, gilt der Steuerbescheid erst am darauffolgenden Werktag als bekannt gegeben. Nun hat der BFH entschieden, dass die Frist für die Zugangsvermutung (drei Tage bzw. nun vier Tage) auch dann gilt, wenn der vom Finanzamt beauftragte Postdienstleister an einem Werktag gar keine Zustellungen vornimmt. An dieser Beurteilung ändert sich auch dann nichts, wenn planmäßig an zwei aufeinanderfolgenden Tagen keine Postzustellung erfolgt, weil der zustellfreie Tag an einen Sonntag grenzt. Die Zustellung innerhalb der Drei-Tages-Frist (bzw. nun Vier-Tages-Frist) wird hierdurch zwar etwas weniger wahrscheinlich, ist aber gleichwohl möglich (BFH-Urteil vom 20.2.2025, VI R 18/22).
» mehrWer ein Gebäude samt bereits installierter Photovoltaikanlage erwirbt, steht vor der Frage, ob auch auf den Kaufpreisanteil für die Photovoltaikanlage Grunderwerbsteuer anfällt. Zu dieser Frage hat das Finanzministerium Sachsen-Anhalt kürzlich Stellung genommen (Erlass vom 16.7.2025, 43 - S 4521 - 45). Der Erlass ist mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder abgestimmt, so dass er bundesweit Bedeutung hat. Vorweg sei darauf hingewiesen, dass auch der Fall behandelt wird, dass ein noch zu errichtendes Gebäude samt Grundstück erworben wird ("einheitlicher Erwerbsgegenstand").
» mehrFahrten eines Arbeitnehmers zu seiner "ersten Tätigkeitsstätte" sind nur mit der Entfernungspauschale abziehbar. Wer aber den Betriebssitz nur gelegentlich aufsucht oder dort nur unwesentliche Arbeiten verrichtet, hat dort grundsätzlich keine erste Tätigkeitsstätte und kann Fahrten dorthin folglich nach Reisekostengrundsätzen geltend machen, also mit 30 Cent je gefahrenem Kilometer oder mit den tatsächlichen Kosten. Davon wiederum gibt es jedoch eine Ausnahme: Fährt ein Arbeitnehmer täglich zu einem Sammelpunkt, um von dort mit einem Fahrzeug des Arbeitgebers weiterzufahren, so sind die Fahrten zum Sammelplatz nur mit der Entfernungspauschale zu berücksichtigen. Diesbezüglich hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass ein Berufskraftfahrer keine erste Tätigkeitsstätte am Betriebssitz des Arbeitgebers hat, wenn er sich dort nur am Wochenanfang bzw. am Wochenende für insgesamt circa vier Stunden die Woche aufhält, seine eigentliche Arbeit aber "auf dem Fahrzeug" leistet. Auch liegen keine Fahrten zu einem Sammelpunkt vor. Folglich sind Fahrten zum Betriebssitz nach Reisekostengrundsätzen abziehbar (FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 25.2.2025, 15 K 3114/23).
» mehrJährlich veröffentlicht das Bundesfinanzministerium die Richtsatzsammlung, die für viele Branchen beispielsweise die gängigen Rohgewinnaufschläge auf den Waren- und Materialeinsatz auflistet. Die Richtsätze sollen der Finanzverwaltung Anhaltspunkte geben, um Umsätze und Gewinne der Gewerbetreibenden zu verproben ("äußerer Betriebsvergleich"). Tatsächlich dient die Richtsatzsammlung oftmals als Schätzungsgrundlage im Anschluss an Betriebsprüfungen, wenn der Prüfer Mängel in der Kassenführung oder Buchführung feststellt. Nun hat der Bundesfinanzhof erhebliche Zweifel geäußert, ob die amtliche Richtsatzsammlung in ihrer bisherigen Form eine geeignete Grundlage für einen äußeren Betriebsvergleich darstellt (BFH-Urteil vom 18.6.2025, X R 19/21).
» mehrBei Ferienwohnungen, die ausschließlich an wechselnde Feriengäste vermietet, also nicht selbstgenutzt werden, müssen die Finanzämter eventuelle Verluste ("Werbungskostenüberschüsse") grundsätzlich anerkennen, auch wenn diese über einen längeren Zeitraum entstehen. Der Nachweis eines Totalüberschusses ist nicht erforderlich; vielmehr wird dieser - anders als bei zeitweise selbstgenutzten Wohnungen - unterstellt. Man spricht dann auch von der Annahme einer Dauervermietung. Eine Dauervermietung - und damit eine Überschusserzielungsabsicht - wird allerdings nur dann unterstellt, wenn die Ferienwohnung im ganzen Jahr - bis auf die üblicherweise vorkommenden Leerstandszeiten - an wechselnde Feriengäste vermietet wird. Bei einem Unterschreiten der ortsüblichen Vermietungszeit von mindestens 25 Prozent hingegen ist die Einkünfteerzielungsabsicht anhand einer Prognose zu überprüfen. Nun hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass bei der Prüfung der erwähnten 25-Prozent-Grenze auf die durchschnittliche Auslastung der Ferienwohnung über einen zusammenhängenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren abzustellen ist. Es ist also nicht nur ein einzelner Veranlagungszeitraum zu betrachten (BFH-Urteil vom 12.8.2025, IX R 23/24).
» mehrVerzichtet ein Ehegatte bereits vor der Heirat auf Ansprüche und erhält er dafür eine Gegenleistung, kann der Vorgang Schenkungsteuer auslösen. Konkret hat der Bundesfinanzhof diesbezüglich entschieden: Erhält ein Ehegatte vor der Eheschließung vom anderen Ehegatten als Ausgleich für einen ehevertraglich vereinbarten Verzicht auf den Anspruch auf Zugewinnausgleich, den nachehelichen Unterhalt und die Hausratsaufteilung ein Grundstück, ist dies als freigebige Zuwendung zu beurteilen (BFH-Urteil vom 9.4.2025, (II R 48/21).
» mehr