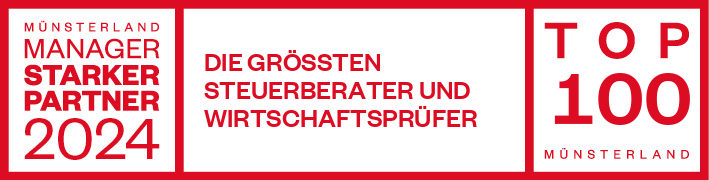Eltern erhalten für ihre Kinder verschiedene steuerliche Begünstigungen, insbesondere das Kindergeld bzw. den Kinderfreibetrag und den Betreuungsfreibetrag. Alleinerziehende erhalten zudem den Entlastungsbetrag nach § 24b EStG. Das Regelwerk für diese Begünstigungen kann allerdings recht kompliziert sein und hält mit der Lebenswirklichkeit zuweilen nicht Schritt. So basieren die steuerlichen Vorschriften nämlich - bei alleinerziehenden Eltern - im Wesentlichen darauf, dass ein Kind lediglich bei einem Elternteil gemeldet ist und dort auch wohnt. Der Gesetzgeber orientiert sich bei Kindern alleinerziehender Eltern also am so genannten Residenzmodell. Doch zunehmend wird das so genannte paritätische Wechselmodell praktiziert, das heißt, dass das Kind zeitweise bei der Mutter und zeitweise beim Vater wohnt, also über zwei "Haushaltszugehörigkeiten" verfügt. Der Bundesfinanzhof hat sich in einem aktuellen Urteil mit zahlreichen Fragen rund um die steuerlichen Begünstigungen für Kinder beim paritätischen Wechselmodell befasst (BFH-Urteil vom 10.7.2024, III R 1/22).
» mehrBeamtenrechtliche Pensionen gelten steuerlich als Versorgungsbezüge, die in voller Höhe steuerpflichtig sind. Abgemildert wird die steuerliche Belastung durch den Versorgungsfreibetrag und den Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag. Der jeweils anzuwendende Prozentsatz verringert sich jedoch seit 2005 (§ 19 Abs. 2 Satz 3 EStG). Wer heutzutage in den Ruhestand tritt, erhält nur noch einen recht geringen Versorgungsfreibetrag. Früher war dieser wesentlich höher. Bei einem Versorgungsbeginn beispielsweise im Jahre 2007 betrug der Versorgungsfreibetrag 36,8 Prozent der Versorgungsbezüge, höchstens 2.760 Euro plus einem Zuschlag von 828 Euro. Manchmal kann das "Jahr des Versorgungsbeginn", das für die Höhe des Versorgungsfreibetrages maßgebend ist, jedoch umstritten sein. Diesbezüglich hat das Hessische Finanzgericht entschieden: Bei einer nachträglich internen Teilung eines laufenden beamtenrechtlichen Versorgungsbezugs gilt für die Höhe der Versorgungsfreibeträge nach § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG das Jahr des Eintritts des ausgleichspflichtigen Ehegatten in den Ruhestand auch als Versorgungsbeginn beim ausgleichsberechtigten Ehegatten (Hessisches FG, Urteil vom 5.6.2024, 4 K 1272/23).
» mehrBis Ende 2024 durften Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern eine Inflationsausgleichsprämie zahlen, die bis zur Höhe von 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei blieb. Die Zahlung musste aber "zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" erfolgen (§ 3 Nr. 11c EStG). Diesbezüglich kam offenbar vermehrt die Frage auf, ob Lohnerhöhungen, die beispielsweise Anfang 2025 vereinbart werden, für die Steuerfreiheit der Prämie rückwirkend schädlich sein könnten. Denn es könnte seitens der Finanzverwaltung möglicherweise unterstellt werden, dass der Arbeitgeber die Prämie letztlich doch anstelle einer eigentlich von vornherein geplanten Lohnerhöhung gezahlt hat.
» mehrWird ein Firmen-Pkw privat genutzt oder besteht zumindest die Möglichkeit einer Privatnutzung, ist der Privatanteil zu versteuern. Es gilt der "Beweis des ersten Anscheins", der fast immer für eine Privatnutzung eines Fahrzeugs spricht. Im Prinzip gibt es nur zwei Möglichkeiten, den Anscheinsbeweis einer Privatnutzung zu entkräften. Erstens, wenn für Privatfahrten ein weiteres Fahrzeug zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung steht. Voraussetzung für eine solche Entkräftung ist jedoch, dass dieses Privatfahrzeug in Status und Gebrauchswert vergleichbar ist. Zweitens kann der Anscheinsbeweis einer Privatnutzung durch ein Fahrtenbuch erschüttert werden. Beide Möglichkeiten haben aber jeweils einen Haken: Die Finanzämter zweifeln die Vergleichbarkeit der Fahrzeuge oftmals an oder wenden ein, dass das Fahrzeug im Privatvermögen auch durch den Ehegatten oder die volljährigen Kinder genutzt werden konnte. Und ein Fahrtenbuch wiederum wird nur akzeptiert, wenn dieses "ordnungsgemäß" ist und keinerlei Mängel enthält. Nun hat der Bundesfinanzhof aber zugunsten der Betriebsinhaber wie folgt entschieden: Bei der Prüfung, ob der für eine private Nutzung betrieblicher Fahrzeuge streitende Anscheinsbeweis erschüttert ist, müssen sämtliche Umstände berücksichtigt werden. Ein Fahrtenbuch darf nicht von vornherein mit der Begründung außer Betracht gelassen werden, es handele sich um ein nicht ordnungsgemäßes Fahrtenbuch (BFH-Urteil vom 22.10.2024, VIII R 12/21).
» mehrFür das Erbe, das ein Kind von Vater oder Mutter erhält, wird erbschaftsteuerlich ein Freibetrag von 400.000 Euro gewährt. Erbt das Kind von Großvater oder Großmutter, beträgt der Freibetrag nur 200.000 Euro. Allerdings erhöht sich der Freibetrag auf 400.000 Euro, wenn die Kinder des Erblassers oder der Erblasserin bereits vorher gestorben sind. Das heißt, der Freibetrag beträgt 400.000 Euro, wenn die Enkelkinder im Zeitpunkt der Erbschaft von den Großeltern bereits (Halb-)Waisen sind. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass es bei dem Freibetrag von 200.000 Euro für eine Erbschaft von einem Großelternteil auch dann bleibt, wenn deren Kind nicht verstorben ist, sondern vorab vertraglich auf sein Erbe verzichtet hat (BFH-Urteil vom 31.7.2024, II R 13/22).
» mehrWer eine vermietete Immobilie verkauft, auf der noch Darlehen ruhen, löst die Kredite oftmals mit dem Veräußerungserlös ab, selbst wenn er dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen muss. Eine Vorfälligkeitsentschädigung ist steuerlich grundsätzlich nicht abziehbar, wenn sie für die Ablösung eines Darlehens gezahlt wird, das seinerzeit für die Finanzierung der jetzt veräußerten Immobilie aufgenommen wurde (FG Köln, Urteil vom 19.10.2023, 11 K 1802/22). Etwas anderes kann aber gelten, wenn nicht das Objekt verkauft wird, für das das Darlehen aufgenommen worden ist, sondern ein Objekt, das lediglich als zusätzliche Sicherheit für die Banken gedient hat. Dies hat kürzlich das Niedersächsische Finanzgericht entschieden (Urteil vom 30.10.2024, 3 K 145/23).
» mehrWer unverschuldet geschädigt wird und dem deshalb vom Schädiger oder dessen Versicherung ein Verdienstausfall ersetzt wird, muss die Zahlung grundsätzlich versteuern (§ 24 Nr. 1a EStG). Wenn dieser Ersatz mehrere Jahre betrifft und zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum geleistet wird, ist er nach der so genannten Fünftelregelung des § 34 EStG immerhin ermäßigt zu besteuern. Doch Vorsicht: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass keine "Zusammenballung" vorliegt, wenn die Verdienstausfallentschädigung nach der "modifizierten Nettolohnmethode" berechnet wird und dem Geschädigten die Einkommensteuer erst in einem späteren Veranlagungszeitraum von der Versicherung erstattet wird. Es kommt dann keine Steuerermäßigung nach der Fünftelregelung infrage (BFH-Urteile vom 15.10.2024, IX R 5/23 und IX R 26/23).
» mehrLebensversicherungen, deren Vertragsabschluss vor dem Jahr 2005 liegt, waren - und sind - steuerlich privilegierter als Versicherungsverträge jüngeren Datums. Vereinfacht ausgedrückt ist die Versicherungsleistung von Altverträgen im Erlebensfall komplett steuerfrei, wenn die Vertragslaufzeit mindestens zwölf Jahre beträgt. Dies gilt nicht nur für Kapitallebensversicherungen, sondern auch für Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht. Aber: Wird bei Fälligkeit das Kapitalwahlrecht nicht ausgeübt, sondern eine Rentenzahlung gewünscht, so sind diese Renten - nach Auffassung der Finanzverwaltung - mit dem so genannten Ertragsanteil steuerpflichtig. Die Höhe des Ertragsanteils richtet sich nach dem Lebensalter des Berechtigten zu Beginn der Rentenzahlung.
» mehrDie Bemessungsgrundlage für die Erbschaftsteuer wird um Nachlassverbindlichkeiten gemindert. Darunter fallen auch die Kosten, die "dem Erwerber unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung, Regelung oder Verteilung des Nachlasses oder mit der Erlangung des Erwerbs entstehen". Dies sind die so genannten Nachlassregelungskosten. Nachlassverwaltungs- bzw. -verwertungskosten sind hingegen nicht abziehbar. In der Praxis führt die Unterscheidung zwischen den einzelnen Kostenarten oft zu Streit mit dem Finanzamt. Kürzlich hat der Bundesfinanzhof erfreulicherweise entschieden, dass Kosten für die Lagerung von Nachlassgegenständen bis zu deren Veräußerung oder Versteigerung abziehbar sind, da sie den Nachlassregelungskosten zuzuordnen sind. Gleiches gilt für Beratungskosten im Zusammenhang mit der Veräußerung des Nachlasses (BFH-Urteil vom 21.8.2024, II R 43/22).
» mehrVermieter, die hohe Mietausfälle zu beklagen haben, sollten unbedingt den Stichtag 31. März 2025 beachten: Falls sie bei vermieteten Wohnungen oder Gebäuden im Jahre 2024 ohne eigenes Verschulden erhebliche Mietausfälle erlitten haben, können Vermieter nämlich einen teilweisen Erlass der Grundsteuer beantragen - und zwar bei der zuständigen Gemeindeverwaltung bzw. in Berlin, Hamburg und Bremen (nicht aber Bremerhaven) beim Finanzamt.
» mehr