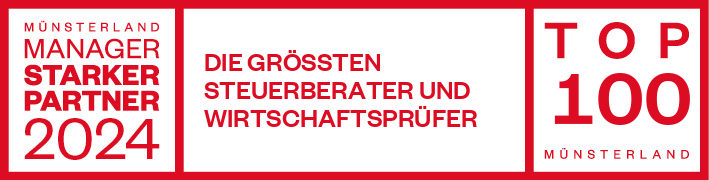Überlässt der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung, so ist dieser geldwerte Vorteil zu versteuern, und zwar entweder nach der Fahrtenbuch-Methode oder pauschal nach der so genannten Ein-Prozent-Regelung. Gewisse Aufwendungen, die vom Arbeitnehmer selbst getragen werden, mindern den geldwerten Vorteil, etwa Treibstoffkosten, Wartungs- und Reparaturkosten, Kraftfahrzeugsteuer (BMF-Schreiben vom 21.9.2017, BStBl 2017 I S. 1336). Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass selbst getragene Maut, Fähr- und Parkkosten bei Privatfahrten jedoch nicht zu einer Minderung des geldwerten Vorteils bei der Pauschalregelung führen. Nur solche vom Arbeitnehmer getragenen Aufwendungen können den geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Fahrzeugs als Einzelkosten mindern, die bei einer (hypothetischen) Kostentragung durch den Arbeitgeber Bestandteil dieses Vorteils und somit von der Abgeltungswirkung der Ein-Prozent-Regelung erfasst wären (BFH-Urteil vom 18.6.2024, VIII R 32/20). Eine Kostentragung des Arbeitgebers für Maut, Fähr- und Parkkosten, die dem Arbeitnehmer auf Privatfahrten entstünden, würde einen eigenständigen geldwerten Vorteil des Arbeitnehmers neben dessen Vorteil aus der reinen Überlassung des Fahrzeugs für Privatfahrten begründen. Daraus ergebe sich im Umkehrschluss, dass der geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers aus der Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs nicht gemindert werde, wenn der Arbeitnehmer diese Aufwendungen trage. Dies gelte ebenso für den Wertverlust aus einem vom Steuerpflichtigen erworbenen Fahrradträger in Höhe der AfA.
» mehrDer Gewinn aus dem Verkauf von Anteilen an einer GmbH oder einer anderen Kapitalgesellschaft ist nach § 17 EStG steuerpflichtig, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 Prozent beteiligt war. Der steuerpflichtige Gewinn wird um "unmittelbare" Veräußerungskosten gemindert. Der Bundesfinanzhof muss nun aber entscheiden, ob auch Steuerberatungskosten, die angefallen sind, um den Veräußerungsgewinn nach § 17 EStG zu ermitteln, als Veräußerungskosten gelten, das heißt, ob auch diese "mittelbaren" Aufwendungen abzugsfähig sind. Vorausgegangen ist ein - für den Steuerpflichtigen - positives Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 22.2.2024 (10 K 1208/23; Az. der Revision: IX R 12/24).
» mehrDie Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten. Auch die Finanzbehörden unterliegen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten den Vorschriften der DSGVO, allerdings erlaubt § 29b AO die Verarbeitung der persönlichen Daten, soweit dies aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich ist. Kürzlich hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass Finanzämter von Vermietern die Mietverträge anfordern dürfen, auch wenn sie dadurch Einblick in personenbezogene Daten der Mieter erhalten. Das Verlangen, Unterlagen vorzulegen, muss zwar notwendig und verhältnismäßig sein, doch die Anforderungen an die Finanzämter sind insoweit nicht streng auszulegen (BFH-Urteil vom 13.8.2024, IX R 6/23). Der Kläger erzielte Vermietungseinkünfte aus mehreren Objekten. Er fügte seiner Einkommensteuererklärung Aufstellungen der Mieteinnahmen, der Abschreibung, der Verwaltungs- und der Instandhaltungsaufwendungen sowie sonstiger Aufwendungen für das jeweilige Haus vor. Das Finanzamt forderte daraufhin zusätzlich Kopien der aktuellen Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen sowie Nachweise über geltend gemachte Erhaltungsaufwendungen an. Der Vermieter kam der Aufforderung nur teilweise nach. So übersandte er dem Finanzamt zwar bestimmte Aufstellungen, doch die Namen der Mieter hatte er geschwärzt. Die angeforderten Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen reichte er gar nicht ein. Er teilte mit, dass die Offenlegung dieser Unterlagen im Hinblick auf die Grundsätze der DSGVO ohne vorherige Einwilligung der Mieter nicht möglich sei. Zudem sei eine Berechtigung zur Unterlagenanforderung nicht ersichtlich, da die Mietverträge zur Prüfung der tatsächlichen Einkünfte untauglich seien. Gegen die Aufforderung zur Vorlage der Unterlagen erhob der Vermieter Einspruch. Sein Rechtsbehelf, die anschließende Klage und nun auch die Revision blieben aber ohne Erfolg. Die Entscheidung des Finanzamts, den Vermieter zur Abgabe der Mietverträge aufzufordern, ist nicht zu beanstanden.
» mehrArbeitgeber müssen neben der Umlage U1 für Krankheitsaufwendungen und der Umlage U2 für Mutterschaftsaufwendungen auch die Umlage U3 für Insolvenzgeld zahlen. Zum 1.1.2025 wurde der Umlagesatz für das Insolvenzgeld von 0,06 Prozent auf 0,15 Prozent angehoben. Dies ist in § 360 SGB III geregelt, der den gesetzlichen Umlagesatz festlegt.
» mehrKrankheitskosten, die Steuerbürger selbst getragen haben, sind als außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG absetzbar. Allerdings wird eine zumutbare Eigenbelastung gegengerechnet. Die Krankheitskosten müssen "zwangsläufig" entstanden sein, wobei dieser Nachweis im Falle von Arznei-, Heil- und Hilfsmittel durch die Verordnung eines Arztes oder eines Heilpraktikers zu erbringen ist (§ 64 Abs.1 Nr. 1 EStDV).
» mehrDie Grunderwerbsteuer ist nicht nur beim Kauf von Grund und Boden oder eines Gebäudes zu entrichten, sondern auch bei der Bestellung und bei der Verlängerung eines Erbbaurechts. Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist im letztgenannten Fall der kapitalisierte Erbbauzins für den Verlängerungszeitraum. Eine Abzinsung des Kapitalwerts auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung über die Verlängerung des Erbbaurechts ist nicht vorzunehmen (BFH-Urteil vom 10.7.2024, II R 3/22). Die Klägerin ist Erbbauberechtigte an einem Grundstück. Das Erbbaurecht wurde im Jahre 1989 begründet. Es ist verbunden mit dem Sondereigentum an einem auf dem Grundstück errichteten Hotel. Da die Klägerin plante, das Hotel nach einer Renovierung weiter zu betreiben, wurde der Erbbaurechtsvertrag im Jahre 2018 dahin geändert, dass die Laufzeit des Erbbaurechts um weitere 44 Jahre verlängert und der bisherige Erbbauzins erhöht wurde. Das Finanzamt setzte daraufhin Grunderwerbsteuer fest. Bemessungsgrundlage war der kapitalisierte Erbbauzins. Der jährliche Erbbauzins betrug 3.369.563 Euro. Aufgrund der Laufzeitverlängerung von 44 Jahren ergab sich auf der Grundlage von § 13 Abs. 1 BewG i.V.m. der Anlage 9a zum BewG ein Vervielfältiger von 16,910. Bei Anwendung dieses Vervielfältigers betrug der kapitalisierte Erbbauzins für den Verlängerungszeitraum danach 56.979.310 Euro. Dieser Betrag unterlag der Grunderwerbsteuer in voller Höhe. Hiergegen wandte sich die Erbbauberechtigte. Sie war der Auffassung, dass der Erbbauzins für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage deutlich abgezinst werden müsste. Doch mit ihrem Anliegen ist sie in letzter Instanz gescheitert.
» mehrDer Bundesrat hat dem Jahressteuergesetz 2024 am 22. November 2024 zugestimmt. Das Gesetz enthält zahlreiche Neuregelungen für Kleinunternehmer.
» mehrFür bestimmte Photovoltaikanlagen gilt seit 2022 eine gesetzliche Ertragsteuerbefreiung (§ 3 Nr. 72 EStG). Im Gegenzug sind Betriebsausgaben seit 2022 nicht mehr abziehbar. Doch wie sind so genannte nachlaufende Betriebsausgaben steuerlich zu behandeln, also beispielswiese eine in 2022 geleistete Umsatzsteuer-Nachzahlung für das Jahr 2021? Das Finanzgericht Nürnberg hat hierzu entschieden, dass ab dem Veranlagungszeitraum 2022 keine Betriebsausgaben für steuerbefreite Photovoltaikanlagen mehr abgezogen werden dürfen, selbst wenn diese auf steuerpflichtige Einnahmen früherer Veranlagungszeiträume entfallen (Urteil vom 19.9.2024, 4 K 1440/23). Der Kläger betreibt eine seit 2022 steuerbefreite Photovoltaikanlage. Die Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2021 wurde in 2022 beim Finanzamt eingereicht; der Nachzahlungsbetrag wurde in 2022 entrichtet. Für das Jahr 2022 reichte der Kläger eine Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG ein, in der die Umsatzsteuer für 2021 in Höhe von rund 864 Euro als Betriebsausgabe erschien. Entsprechend machte er in seiner Einkommensteuererklärung 2022 einen Verlust aus Gewerbebetrieb in Höhe von 864 Euro geltend. Das Finanzamt erkannte diesen Verlust nicht an. Es verwies darauf, dass Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit steuerfreien Betriebseinnahmen stünden, nicht als Ausgaben berücksichtigt werden könnten. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg. Für die Auslegung durch das Gericht war in erster Linie der reine Wortlaut des Gesetzestextes, hier des § 3 Nr. 72 Satz 2 EStG, maßgeblich. Dieser spreche eindeutig davon, dass bei Vorliegen steuerbefreiter Einnahmen kein Gewinn zu ermitteln "ist".
» mehrKinderbetreuungskosten sind unter bestimmten Voraussetzungen als Sonderausgaben absetzbar, und zwar mit zwei Drittel der Aufwendungen, höchstens 4.000 Euro je Kind. Begünstigt sind Dienstleistungen zur Betreuung eines Kindes, das zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört und das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Dazu gehören auch Kindergartenbeiträge. Zeitlich unbegrenzt kann ein Abzug erfolgen, wenn das Kind behindert ist, diese Behinderung vor dem 25. Geburtstag eingetreten ist und das Kind außerstande ist, sich selbst zu unterhalten (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG). Ab dem 1.1.2025 wird die Begrenzung von zwei Drittel der Aufwendungen auf 80 Prozent der Aufwendungen und der Höchstbetrag auf 4.800 Euro erhöht. Dies wurde mit dem Jahressteuergesetz 2024 beschlossen.
» mehr