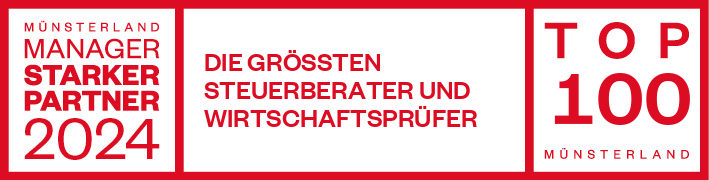Wer aus Anlagean- und -verkäufen Gewinne oder Verluste erzielt, muss beachten, dass diese steuerlich unterschiedlich zu behandeln sein können. Zumeist liegen Einkünfte aus Kapitalvermögen vor, die dem Abgeltungsteuersatz unterliegen, beispielsweise bei Aktiengeschäften. Es können aber auch so genannte private Veräußerungsgeschäfte vorliegen, die nur dann steuerlich relevant sind, wenn zwischen An- und Verkauf mehr als zehn Jahre (Immobilien) bzw. ein Jahr (andere Wirtschaftsgüter wie z.B. Edelmetalle) liegen. Und es kann auch der Fall eintreten, dass eine Tätigkeit so nachhaltig und intensiv ausgeübt wird, dass sogar die Grenze zur Gewerblichkeit überschritten ist. Dann sind die Gewinne aus - eigentlich privaten - Veräußerungsgeschäften selbst dann steuerpflichtig, wenn zwischen An- und Verkauf mehr als ein Jahr (bzw. bei Immobilien zehn Jahre) vergangen ist. Mit der Frage, wann die Grenze zur Gewerblichkeit überschritten ist, muss sich der BFH in dem Verfahren mit dem Az. X R 13/25 befassen. Vorausgegangen ist ein Urteil des Finanzgerichts München vom 3.4.2025 (11 K 2041/21). Im Urteilsfall hatte der Kläger einen Gewinn aus umfassenden Devisentermingeschäften erzielt. Dieser sollte nach dem Willen des Klägers - weitestgehend - steuerfrei bleiben, da lediglich private Veräußerungsgeschäfte vorgelegen hätten und zwischen "An- und Verkauf" mehr als ein Jahr gelegen hätte. Das Finanzamt hingegen unterstellte Einkünfte aus Gewerbebetrieb, weil der Kläger mit seiner umfassenden Tätigkeit die Grenze der privaten Vermögensverwaltung überschritten habe. Die hiergegen gerichtete Klage war erfolgreich.
» mehrKosten eines Rechtsstreits (Prozesskosten) sind nur dann als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig, wenn der Steuerpflichtige ohne die Aufwendungen Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können (§ 33 Abs. 2 Satz 4 EStG). Diesbezüglich hat das Niedersächsische Finanzgericht entschieden, dass Prozesskosten auch dann nicht abziehbar sind, wenn ein Steuerbürger hohe Summen bei Online-Wettanbietern verloren hat und er nun gerichtlich versucht, sein verlorenes Geld zurückzuholen. Zumindest gilt das Abzugsverbot, wenn keine absolute Existenznot besteht (FG Niedersachsen, Urteil vom 10.6.2025, 13 K 157/24). Der Kläger hatte über 130.000 Euro bei Online-Glücksspielen verloren und sogar Kredite aufnehmen müssen, um seine Schulden begleichen zu können. Obendrein verlor er seine Arbeitsstelle und wurde arbeitsunfähig. Im Streitjahr 2023 erhielt er eine private Arbeitsunfähigkeitsrente und Krankengeld. Da sich offenbar in einiger Zeit eine Überschuldung abzeichnete, verklagte er die Wettanbieter. Seine Klagen waren zwar durchaus erfolgreich, weil die angebotenen Online-Glückspiele seinerzeit gesetzlich verboten waren. Doch durchsetzen konnte der Kläger seine Ansprüche nicht, da die Anbieter mit Sitz im Ausland bereits insolvent waren oder Berufung eingelegt haben. Der Kläger ist zumindest vorerst auf Prozesskosten von rund 14.500 Euro "sitzen geblieben". Einen Abzug dieser Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen ließen weder das Finanzamt noch das Finanzgericht zu.
» mehrDie Einkünfte, die Steuerpflichtige aus einer ausländischen Betriebsstätte erzielen, sind in Deutschland üblicherweise steuerfrei und unterliegen (nur) der ausländischen Besteuerung. Der Bundesfinanzhof hat nun konkretisiert, wann von einer ausländischen Betriebsstätte auszugehen ist (BFH-Urteile vom 18.12.2024, I R 47/21 und I R 39/21). Im Grundfall I R 47/21 hatte ein in Deutschland lebender Taxiunternehmer (Kläger) aufgrund seiner Mitgliedschaft in einer Schweizerischen Taxifunkzentrale Zugang zu deren Büroraum in der Schweiz. Dieser Raum war mit drei Arbeitsplätzen eingerichtet und stand insgesamt drei Taxiunternehmern zur Verfügung. Der Kläger nutzte den Büroraum (einschließlich eines abschließbaren Standcontainers) für geschäftsleitende Tätigkeiten sowie für die Personalverwaltung seiner angestellten Taxifahrer, die Vorbereitung der laufenden Buchführung, das Rechnungswesen, die Finanzkontrolle sowie die Kontrolle der Einhaltung behördlicher Auflagen.
» mehrFür ein Kind, das sich in einer Zweitausbildung befindet, etwa ein Studium nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung, kann Kindergeld zu gewähren sein. Voraussetzung ist aber grundsätzlich, dass das Kind nebenher nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet. Erfährt die Familienkasse, dass das Kind doch mehr als 20 Stunden arbeitet bzw. gearbeitet hat, wird sie die Festsetzung des Kindergeldes verweigern oder nachträglich aufheben. Doch wie ist der Fall zu beurteilen, wenn die Eltern die Familienkasse frühzeitig über die Arbeitsaufnahme des Kindes (mit mehr als 20 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit) informiert haben, die Familienkasse aber hierauf nicht reagiert und das Kindergeld - fälschlicherweise - über Monate weiter ausgezahlt hat? Darf sie das Kindergeld dann trotzdem zurückfordern? Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die Änderung der Kindergeldfestsetzung in einem solchen Fall einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben darstellen kann. Die Änderung des Bescheides bzw. die Rückforderung des Kindergeldes kann dann rechtswidrig sein (FG Düsseldorf, Urteil vom 8.3.2024, 15 K 1957/23 Kg). Es liegt allerdings zwischenzeitlich die Revision beim Bundesfinanzhof vor (Az. III R 43/24).
» mehrViele Unternehmen laden ihre Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier ein. In steuerlicher Hinsicht ist dabei einiges zu beachten. So bleiben Zuwendungen des Arbeitgebers anlässlich einer Weihnachtsfeier bis zu einem Betrag von 110 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) pro Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei. Dabei handelt es sich um einen Freibetrag und nicht mehr - wie früher - um eine Freigrenze. Falls also die Zuwendungen des Arbeitgebers höher sind, ist nur der übersteigende Betrag zu versteuern und nicht mehr der gesamte Betrag. Statt individueller Besteuerung kann der Arbeitgeber den steuerpflichtigen Vorteil auch pauschal mit 25 Prozent versteuern. Als Zuwendungen gelten alle Aufwendungen des Arbeitgebers, gleichgültig, ob diese einem Arbeitnehmer individuell zurechenbar sind oder ob sie in einem rechnerischen Anteil an den Kosten der Weihnachtsfeier bestehen. Erfasst werden also nicht nur die Kosten für das Essen und die Getränke, sondern auch die Kosten für den äußeren Rahmen, wie Raummiete, Eventmanager, Musikkapelle, Busfahrt, Eintrittskarten. Zu den Gesamtkosten gehören ebenfalls Geschenke unabhängig von deren Wert, die anlässlich der Weihnachtsfeier überreicht werden. Außen vor bleiben Geschenke, die nicht anlässlich, sondern "nur bei Gelegenheit" der Betriebsveranstaltung zugewendet werden. Es wird nicht beanstandet, wenn Geschenke, deren Wert je Arbeitnehmer 60 Euro nicht übersteigt, als Zuwendungen anlässlich einer Betriebsveranstaltung in die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Freibetrags einbezogen werden (BMF-Schreiben vom 07.12.2016, IV C 5 - S 2332/15/10001). Die Gesamtkosten der Weihnachtsfeier werden durch die Zahl der teilnehmenden Personen geteilt. Falls Angehörige des Arbeitnehmers an der Feier teilnehmen, sind die anteiligen Aufwendungen der Begleitperson dem Arbeitnehmer zuzurechnen. Das bedeutet, dass die Begleitpersonen keinen eigenen Freibetrag erhalten.
» mehrDas Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hat entschieden, dass die medizinische Empfehlung zur Entnahme und Lagerung von Eizellen, um gegebenenfalls später einen Kinderwunsch zu ermöglichen ("social freezing"), allein nicht ausreicht, um die Kosten als außergewöhnliche Belastungen abziehen zu können. Dies gilt auch bei einem zuvor diagnostiziertem PCO-Syndrom (Schleswig-Holsteinisches FG, Urteil vom 19.3.2025, 2 K 80/24).
» mehrDer Gesetzgeber hat eine "Elektroauto-AfA" eingeführt. Für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge kann nun eine arithmetisch-degressive Abschreibung mit fallenden Staffelsätzen in Anspruch genommen werden. Die Elektroau-to-AfA beträgt 75 Prozent im Jahr der Anschaffung, 10 Prozent im ersten darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im zweiten darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im dritten darauffolgenden Jahr, 3 Prozent im vierten darauf folgenden Jahr und 2 Prozent im fünften darauf folgenden Jahr (§ 7 Abs. 2a EStG). Nach der Gesetzesbegründung umfasst die Regelung ausschließlich "neu angeschaffte", rein elektrisch betriebene Fahrzeuge des Betriebsvermögens (BT-Drucksache 21/323). Sie wird für Anschaffungen im Zeitraum von Juli 2025 bis Dezember 2027 befristet eingeführt. Die Formulierung "neu angeschaffte" ist offenbar vielfach so verstanden worden, dass nur "neue" Fahrzeuge von der Elektroauto-AfA begünstigt sind. Herr Ralf Hörster, Ministerialrat und Referatsleiter im Bundesfinanzministerium, weist in einem Aufsatz für die Fachzeitschrift Neue Wirtschafts-Briefe aber ausdrücklich hin, dass die Regelung nicht auf Neufahrzeuge beschränkt ist. Dies sei im Zuge der parlamentarischen Beratungen klargestellt worden (NWB 29/2025, Seite 1970).
» mehrDas Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) warnt vor betrügerischen E-Mails, die vorgeben, von ihm zu stammen. Vereinzelt sind auch vermeintliche Schreiben des BZSt über den postalischen Weg im Umlauf. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele der Betrugsversuche (Quelle: www.bzst.de).
» mehrBildungsleistungen können unter bestimmten Voraussetzungen umsatzsteuerfrei sein. Nun hat der Bundesfinanzhof aber entschieden: Die Erteilung von Reitunterricht ist nicht von der Umsatzsteuer befreit, es sei denn, der Unterricht dient der Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung (BFH-Urteil vom 22.1.2025, XI R 9/22). Es ging um folgenden Sachverhalt: Der Kläger begehrte die Steuerbefreiung verschiedener Reitkurse für Kinder und Jugendliche auf seinem Reiterhof in den Jahren 2007 bis 2011. In der "Ponygruppe" wurden Kinder und Jugendliche, bei "Klassenfahrten" wurden Schulklassen im Umgang mit Pferden unterrichtet. Zudem wurden Kurse für eine "Große Pferdegruppe" angeboten, die auf das Ablegen von Leistungsabzeichen gerichtet waren. Die unterrichteten Kinder und Jugendlichen wurden überdies verpflegt und übernachteten teilweise auch auf dem Reiterhof. Das Finanzamt vertrat den Standpunkt, dass sämtliche Leistungen steuerpflichtig seien. Der BFH sieht die Sache wie folgt: Bei der Beherbergung und Verpflegung von Kindern und Jugendlichen handelt es sich um selbstständige steuerbare Leistungen. Die entsprechenden (Teil-)Umsätze sind steuerpflichtig. Für den Unterricht kommt eine Steuerbefreiung nur in Betracht, wenn dieser tatsächlich auf einen Beruf vorbereitet. Die Kurse der "Ponygruppe" und für Schulklassen im Rahmen der "Klassenfahrten" sind folglich umsatzsteuerpflichtig. Bei den Kursen der "Großen Pferdegruppe" liegen hingegen die strengen Voraussetzungen für eine Steuerfreiheit vor, da zahlreiche Teilnehmer später Turniersportreiter wurden.
» mehrAuch die Bildung von Wohneigentum wurde in die Riester-Förderung einbezogen. So darf das Kapital des Altersvorsorgevertrages beispielsweise zur Tilgung eines Darlehens genutzt werden, das für die Anschaffung oder Herstellung eines Eigenheims aufgenommen wurde. Man spricht auch von einer "wohnungswirtschaftlichen Verwendung". Geregelt ist dies in § 92a und b EStG. Jedoch stellen sich immer wieder Fragen, wenn es darum geht, inwieweit das Kapital des Altersvorsorgevertrages tatsächlich "wohnungswirtschaftlich" verwendet werden darf. Nun hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Tilgung eines von dem Ehegatten aufgenommenen Darlehens keine wohnungswirtschaftliche Verwendung des Kapitals ist. Folglich ist eine solche Verwendung unzulässig, das heißt, das Kapital kann nicht für die Tilgung eines Darlehens des Ehegatten genutzt werden (BFH Urteil vom 2.4.2025, X R 6/22).
» mehr