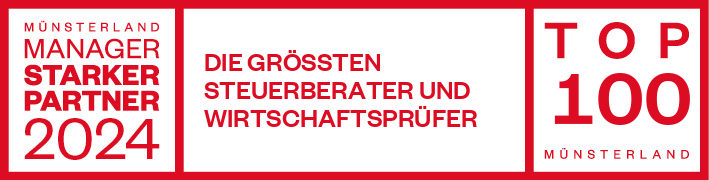Manchmal weist ein Unternehmer in einer Rechnung 19 Prozent Umsatzsteuer aus, obwohl nur der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent anzuwenden gewesen wäre. Prinzipiell wird die Steuer, die in der Rechnung ausgewiesen wird, aber geschuldet, auch wenn diese zu hoch ist. Es gilt insoweit § 14c Abs. 1 UStG. Der Europäische Gerichtshof hat jedoch mit Urteil vom 8.12.2022 (C-378/21) entschieden, dass ein Steuerpflichtiger den zu Unrecht in Rechnung gestellten Teil der Mehrwertsteuer nicht schuldet, wenn keine Gefährdung des Steueraufkommens vorliegt. Dies ist der Fall, wenn eine Leistung ausschließlich an Endverbraucher erbracht wurde, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Das Urteil ist zwar zu einem Verfahren aus Österreich ergangen, ist aber auch für Deutschland bedeutsam.
» mehrBei der Bearbeitung der Steuererklärung übernimmt das Finanzamt automatisiert zahlreiche Daten, die ihm von bestimmten Unternehmen und Institutionen digital mitgeteilt werden (§ 93c AO). Das sind insbesondere die Daten der Arbeitgeber und der Sozialversicherungsträger (so genannte eDaten). Manchmal werden die Daten aber zu spät übertragen und liegen bei der Veranlagung noch gar nicht vor. Oder aber die übermittelten Daten sind fehlerhaft und werden später geändert. Das kann zunächst zu falschen Steuerbescheiden führen. Für diese Fälle hat der Gesetzgeber der Finanzverwaltung die Möglichkeit eingeräumt, die fehlerhaften Steuerbescheide ohne weitere Voraussetzungen nach § 175b AO zu ändern.
» mehrSolange der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber seine steuerliche Identifikationsnummer nicht mitteilt, muss der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der Steuerklasse VI ermitteln. Trifft den Arbeitnehmer keine Schuld an der fehlenden Mitteilung seiner Identifikationsnummer, hat der Arbeitgeber die voraussichtlichen Lohnsteuer-Abzugsmerkmale längstens für drei Kalendermonate zu Grunde zu legen. Er kann für die Berechnung der Lohnsteuer bei Ledigen also zunächst doch die Steuerklasse I zugrunde legen. Wenn diese drei Monate verstrichen sind, ohne dass der Arbeitnehmer die Identifikationsnummer mitteilt, muss der Arbeitgeber die Steuer indes - rückwirkend - nach der Steuerklasse VI berechnen und ans Finanzamt abführen (§ 39c Abs. 1 EStG). Wie das Niedersächsische Finanzgericht rechtskräftig entschieden hat, gelten diese Regelungen auch bei der Beschäftigung ausländischer Mitarbeiter, die sich mitunter nur wenige Monate in Deutschland aufhalten (Urteil vom 13.3.2024, 3 K 13/24).
» mehrBei Verträgen zwischen nahen Angehörigen oder nahestehenden Gesellschaften verlangen die Finanzämter üblicherweise die Schriftform - anderenfalls wird den Verträgen die steuerliche Anerkennung versagt. Doch nun hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der unterbliebene Abschluss eines schriftlichen Vertrages allein nicht dazu führen darf, dass einem Vertragsverhältnis zwischen nahestehenden Personen oder Gesellschaften die steuerliche Anerkennung zu verweigern ist (BVerfG-Urteil vom 27.5.2025, 2 BvR 172/24). In dem Verfahren ging es um Vereinbarungen zwischen so genannten Schwester-Personengesellschaften. Das Finanzamt wollte einen formlosen Werkvertrag zwischen den beiden Gesellschaften nicht anerkennen und versagte den Abzug von Betriebsausgaben. Es begründete dies damit, dass keine schriftlichen Vereinbarungen vorliegen würden, die die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien geregelt hätten. Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht. Da keine schriftlichen Vereinbarungen vorgelegen hätten, komme es auf die Frage der tatsächlichen Durchführung des Werkvertrages nicht mehr an. Die Revision wurde nicht zugelassen und der Bundesfinanzhof wies die entsprechende Nichtzulassungsbeschwerde zurück (FG Thüringen, Urteil vom 30.3.2022, 1 K 68/17; BFH-Beschluss vom 8.3.2023, IV B 35/22). Doch die Klägerin legte Verfassungsbeschwerde ein, die die Karlsruher Richter sowohl als zulässig als auch als begründet ansahen.
» mehrImmer mehr Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern die kostenlose oder verbilligte Teilnahme an Firmenfitness-Programmen an. Der geldwerte Vorteil aus der Teilnahme ist steuerfrei, wenn die monatliche Freigrenze von 50 Euro für Sachbezüge nicht überschritten wird (§ 8 Abs. 2 EStG). Mit dem Finanzamt kommt es allerdings oft zum Streit darüber, wie der Gesamtbetrag, den der Arbeitgeber aufwendet, auf die Mitarbeiter zu verteilen ist. Das heißt: Kommt es auf die Mitarbeiter an, die für das Firmenfitness-Programm tatsächlich registriert sind, oder auf die vom Arbeitgeber "erworbenen" Lizenzen? Das Niedersächsische Finanzgericht hat diesbezüglich entschieden, dass es auf die Anzahl der vom Arbeitgeber erworbenen Lizenzen nicht ankommt, wenn diese von der Anzahl der tatsächlich registrierten Mitarbeiter abweicht (FG Niedersachsen, Urteil vom 17.4.2024, 3 K 10/24).
» mehrWenn ein Wohnungseigentümer eine Wohnung ganzjährig oder zumindest für einen gewissen Zeitraum an einen Dritten, beispielsweise Sohn oder Tochter, unentgeltlich überlässt, verlangen viele Gemeinden dennoch eine Zweitwohnungsteuer. Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein entschieden: Ein Eigentümer oder Wohnungserbbauberechtigter kann bei Überlassung einer Wohnung an Dritte zur Zweitwohnungsteuer herangezogen werden, soweit er die Wohnung weiterhin hält und sich der Verfügungsmacht über sie nicht begibt. Auf die Hintergründe für die unentgeltliche Überlassung der Wohnung kommt es dabei nicht an. Etwas anderes gilt aber, wenn er sich der Verfügungsmacht begibt (Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 21.1.2025, Az. 6 LB 3/24).
» mehrWer aus Anlagean- und -verkäufen Gewinne oder Verluste erzielt, muss beachten, dass diese steuerlich unterschiedlich zu behandeln sein können. Zumeist liegen Einkünfte aus Kapitalvermögen vor, die dem Abgeltungsteuersatz unterliegen, beispielsweise bei Aktiengeschäften. Es können aber auch so genannte private Veräußerungsgeschäfte vorliegen, die nur dann steuerlich relevant sind, wenn zwischen An- und Verkauf mehr als zehn Jahre (Immobilien) bzw. ein Jahr (andere Wirtschaftsgüter wie z.B. Edelmetalle) liegen. Und es kann auch der Fall eintreten, dass eine Tätigkeit so nachhaltig und intensiv ausgeübt wird, dass sogar die Grenze zur Gewerblichkeit überschritten ist. Dann sind die Gewinne aus - eigentlich privaten - Veräußerungsgeschäften selbst dann steuerpflichtig, wenn zwischen An- und Verkauf mehr als ein Jahr (bzw. bei Immobilien zehn Jahre) vergangen ist. Mit der Frage, wann die Grenze zur Gewerblichkeit überschritten ist, muss sich der BFH in dem Verfahren mit dem Az. X R 13/25 befassen. Vorausgegangen ist ein Urteil des Finanzgerichts München vom 3.4.2025 (11 K 2041/21). Im Urteilsfall hatte der Kläger einen Gewinn aus umfassenden Devisentermingeschäften erzielt. Dieser sollte nach dem Willen des Klägers - weitestgehend - steuerfrei bleiben, da lediglich private Veräußerungsgeschäfte vorgelegen hätten und zwischen "An- und Verkauf" mehr als ein Jahr gelegen hätte. Das Finanzamt hingegen unterstellte Einkünfte aus Gewerbebetrieb, weil der Kläger mit seiner umfassenden Tätigkeit die Grenze der privaten Vermögensverwaltung überschritten habe. Die hiergegen gerichtete Klage war erfolgreich.
» mehrKosten eines Rechtsstreits (Prozesskosten) sind nur dann als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig, wenn der Steuerpflichtige ohne die Aufwendungen Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können (§ 33 Abs. 2 Satz 4 EStG). Diesbezüglich hat das Niedersächsische Finanzgericht entschieden, dass Prozesskosten auch dann nicht abziehbar sind, wenn ein Steuerbürger hohe Summen bei Online-Wettanbietern verloren hat und er nun gerichtlich versucht, sein verlorenes Geld zurückzuholen. Zumindest gilt das Abzugsverbot, wenn keine absolute Existenznot besteht (FG Niedersachsen, Urteil vom 10.6.2025, 13 K 157/24). Der Kläger hatte über 130.000 Euro bei Online-Glücksspielen verloren und sogar Kredite aufnehmen müssen, um seine Schulden begleichen zu können. Obendrein verlor er seine Arbeitsstelle und wurde arbeitsunfähig. Im Streitjahr 2023 erhielt er eine private Arbeitsunfähigkeitsrente und Krankengeld. Da sich offenbar in einiger Zeit eine Überschuldung abzeichnete, verklagte er die Wettanbieter. Seine Klagen waren zwar durchaus erfolgreich, weil die angebotenen Online-Glückspiele seinerzeit gesetzlich verboten waren. Doch durchsetzen konnte der Kläger seine Ansprüche nicht, da die Anbieter mit Sitz im Ausland bereits insolvent waren oder Berufung eingelegt haben. Der Kläger ist zumindest vorerst auf Prozesskosten von rund 14.500 Euro "sitzen geblieben". Einen Abzug dieser Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen ließen weder das Finanzamt noch das Finanzgericht zu.
» mehrDie Einkünfte, die Steuerpflichtige aus einer ausländischen Betriebsstätte erzielen, sind in Deutschland üblicherweise steuerfrei und unterliegen (nur) der ausländischen Besteuerung. Der Bundesfinanzhof hat nun konkretisiert, wann von einer ausländischen Betriebsstätte auszugehen ist (BFH-Urteile vom 18.12.2024, I R 47/21 und I R 39/21). Im Grundfall I R 47/21 hatte ein in Deutschland lebender Taxiunternehmer (Kläger) aufgrund seiner Mitgliedschaft in einer Schweizerischen Taxifunkzentrale Zugang zu deren Büroraum in der Schweiz. Dieser Raum war mit drei Arbeitsplätzen eingerichtet und stand insgesamt drei Taxiunternehmern zur Verfügung. Der Kläger nutzte den Büroraum (einschließlich eines abschließbaren Standcontainers) für geschäftsleitende Tätigkeiten sowie für die Personalverwaltung seiner angestellten Taxifahrer, die Vorbereitung der laufenden Buchführung, das Rechnungswesen, die Finanzkontrolle sowie die Kontrolle der Einhaltung behördlicher Auflagen.
» mehrFür ein Kind, das sich in einer Zweitausbildung befindet, etwa ein Studium nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung, kann Kindergeld zu gewähren sein. Voraussetzung ist aber grundsätzlich, dass das Kind nebenher nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet. Erfährt die Familienkasse, dass das Kind doch mehr als 20 Stunden arbeitet bzw. gearbeitet hat, wird sie die Festsetzung des Kindergeldes verweigern oder nachträglich aufheben. Doch wie ist der Fall zu beurteilen, wenn die Eltern die Familienkasse frühzeitig über die Arbeitsaufnahme des Kindes (mit mehr als 20 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit) informiert haben, die Familienkasse aber hierauf nicht reagiert und das Kindergeld - fälschlicherweise - über Monate weiter ausgezahlt hat? Darf sie das Kindergeld dann trotzdem zurückfordern? Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass die Änderung der Kindergeldfestsetzung in einem solchen Fall einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben darstellen kann. Die Änderung des Bescheides bzw. die Rückforderung des Kindergeldes kann dann rechtswidrig sein (FG Düsseldorf, Urteil vom 8.3.2024, 15 K 1957/23 Kg). Es liegt allerdings zwischenzeitlich die Revision beim Bundesfinanzhof vor (Az. III R 43/24).
» mehr