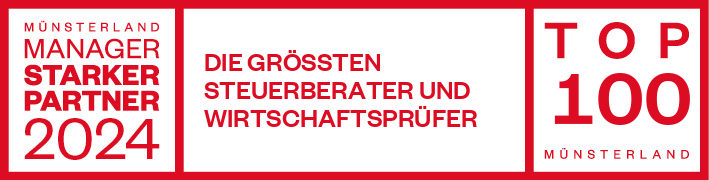Wird ein Steuerbescheid mittels Einspruch angefochten, kann zusätzlich ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gestellt werden, so dass der streitige Steuerbetrag vorläufig nicht entrichtet werden muss - vorausgesetzt, es bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts und das Finanzamt stimmt dem Antrag zu (§ 361 AO). Erfolgen die Einspruchsentscheidung oder ein eventuelles Finanzgerichtsurteil zu Ungunsten des Einspruchsführers, wird das Finanzamt den ausgesetzten Betrag aber nachfordern und zudem Aussetzungszinsen erheben. Die Aussetzungszinsen betragen 0,5 Prozent pro Monat.
» mehrZum 1. Mai 2023 ist das Deutschlandticket an den Start gegangen. Für 49 Euro monatlich können Bürgerinnen und Bürger den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ihren Beschäftigten das Deutschlandticket als Jobticket bereitzustellen. Wenn sie dabei einen Zuschuss von mindestens 25 Prozent auf den Ausgabepreis des Tickets leisten, gewährt das jeweilige Verkehrsunternehmen zusätzlich fünf Prozent Übergangsabschlag bzw. Rabatt auf den Ausgabepreis. Die Zuschüsse des Arbeitgebers zum Erwerb des Deutschlandtickets oder aber auch die vollständig unentgeltliche Gewährung des Tickets sind steuerfrei, wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden. Dies ergibt sich aus § 3 Nr. 15 EStG. Der Arbeitgeber muss den Vorgang im Lohnkonto aufzeichnen und den Zuschuss in der Lohnsteuerbescheinigung bei den steuerfreien Fahrtkostenzuschüssen ausweisen. Bei den Arbeitnehmern sind die geleisteten steuerfreien Zuschüsse auf die als Werbungskosten abziehbaren Fahrtkosten anzurechnen, das heißt, die Entfernungspauschale ist entsprechend zu kürzen.
» mehrUnternehmer, die Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen bzw. vergleichbare Zuschüsse erhalten haben, müssen diese als Betriebseinnahmen versteuern, das heißt, die Hilfen sind einkommen- und gewerbesteuerpflichtig. Das Finanzgericht Münster hat nun entschieden, dass die im Jahr 2020 gezahlten Corona-Hilfen keine außerordentlichen Einkünfte darstellen, die in der Einkommensteuer nur ermäßigt zu besteuern wären. Sie unterliegen folglich nicht der Tarifermäßigung nach der so genannten Fünftel-Regelung (FG Münster, Urteil vom 26.4.2023, 13 K 425/22 E).
» mehrNach § 35c des Einkommensteuergesetzes werden bestimmte energetische Maßnahmen am Eigenheim steuerlich gefördert. Werden die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, können 20 Prozent der Aufwendungen direkt von der Steuerschuld abgezogen werden. Maximal sind 40.000 Euro je Objekt abzugsfähig, und zwar verteilt über drei Jahre: 7 Prozent im ersten und zweiten Jahr, höchstens jeweils 14.000 Euro, und 6 Prozent im dritten Jahr, höchstens 12.000 Euro. Das begünstigte Objekt muss bei Beginn der energetischen Maßnahme älter als zehn Jahre sein. Die Steuerermäßigung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Steuerpflichtige das Gebäude im jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind nur der bürgerlich-rechtliche Eigentümer oder die Miteigentümer eines zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäudes begünstigt. Das bedeutet: Wenn eine Immobilie bereits auf die nachfolgende Generation unter Vorbehalt des Nießbrauchs oder eines Wohnrechts übertragen wurde, scheidet die Förderung nach § 35c EStG aus. In dem BMF-Schreiben vom 14.1.2021 (BStBl 2021 I S. 103) heißt es sinngemäß: Anspruchsberechtigt ist grundsätzlich der bürgerlich-rechtliche Eigentümer. Die dinglich oder schuldrechtlich nutzungsberechtigte Person kann weder wie ein Eigentümer mit der Sache nach Belieben verfahren noch den Eigentümer wirtschaftlich ausschließen. Damit ist sie nicht anspruchsberechtigt. Der Eigentümer seinerseits kann die Steuerermäßigung nicht erhalten, weil diese nur von demjenigen Steuerpflichtigen in Anspruch genommen werden darf, der das Gebäude selbst zu eigenen Wohnzwecken nutzt.
» mehrBei einer Scheidung wird der Versorgungsausgleich durchgeführt. Dabei werden die in der Ehe erworbenen Rentenanrechte zwischen beiden Ehegatten hälftig geteilt. Die Ehegatten können den Versorgungsausgleich aber auch ganz oder teilweise ausschließen. Jüngst hat das Bundesfinanzministerium zur steuerlichen Behandlung von Ausgleichsleistungen zur Vermeidung eines Versorgungsausgleichs Stellung genommen (BMF-Schreiben vom 21.3.2023, IV C 3 - S 2221/19/10035 :001). Es gelten unter anderem die nachfolgenden Grundsätze: Die ausgleichspflichtige Person kann Zahlungen zur Vermeidung des Versorgungsausgleichs auf Antrag als Sonderausgaben abziehen, soweit die ausgleichsberechtigte Person zustimmt (§ 10 Abs. 1a Nr. 3 EStG). Die ausgleichsberechtigte Person muss die Leistung korrespondierend versteuern. Es dürfen sowohl Zahlungen unmittelbar an die ausgleichsberechtigte Person als auch Zahlungen an den Versorgungsträger der ausgleichsberechtigten Person abgezogen werden. Nicht umfasst werden Zahlungen der ausgleichspflichtigen Person an den eigenen Versorgungsträger zur Wiederauffüllung der eigenen Ansprüche. Soweit bei der zahlenden Person die Voraussetzungen für den Sonderausgabenabzug vorliegen, führen die Ausgleichsleistungen beim Empfänger zu steuerpflichtigen sonstigen Einkünften (§ 22 Nr. 1a EStG). Es kommt nicht darauf an, dass sich der Sonderausgabenabzug tatsächlich steuermindernd auswirkt.
» mehrDie Absetzung für Abnutzung (AfA) bei vermieteten Immobilien darf nur von den Anschaffungskosten des Gebäudes, nicht aber vom Wert des Grund und Bodens erfolgen. Wer also ein Haus oder eine Eigentumswohnung erwirbt, muss den einheitlichen Kaufpreis für AfA-Zwecke um den Grund-und-Boden-Anteil kürzen. Um Streitigkeiten über die Höhe des Grund-und-Boden-Anteils nach Möglichkeit von vornherein zu vermeiden, ist zu empfehlen, bereits im notariellen Kaufvertrag eine Aufteilung des Kaufpreises vorzunehmen. Die Finanzämter sind an diese Werte gebunden, "solange dagegen keine nennenswerten Zweifel bestehen" (BFH-Urteil vom 16.9.2015, IX R 12/14).
» mehrBetreut eine Tagespflegeperson Kinder verschiedener Eltern im eigenen Haushalt oder in anderen Räumen eigenverantwortlich, so handelt es sich um eine selbstständige erzieherische Tätigkeit. Die Tagespflegeperson erzielt Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Der Gewinn kann durch eine Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt werden. Bei der Ermittlung der Einkünfte sind die mit der Betreuung verbundenen Aufwendungen als Betriebsausgaben absetzbar, entweder in tatsächlicher Höhe gegen Nachweis oder ganz einfach in Höhe der Betriebsausgabenpauschale. Diese betrug bislang 300 Euro je Kind und Monat. Bund und Länder haben sich nunmehr aber darauf geeinigt, die Betriebsausgabenpauschale für selbständige Tagesmütter und -väter auf 400 Euro je Kind und Monat anzuheben. Die Erhöhung gilt ab dem Jahr 2023 (BMF-Schreiben vom 6.4.2023, IV C 6-S 2246/19/10004 :004).
» mehrDie Ermittlung des Gewerbeertrags für Zwecke der Gewerbesteuer ist zwar in vielerlei Hinsicht identisch mit der Ermittlung des Gewinns für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer. Doch einige Tücken hält das Gewerbesteuerrecht bereit. Beispielsweise ist zu berücksichtigen, dass die Gewerbesteuerpflicht das Vorhandensein eines Gewerbebetriebs voraussetzt. Das wiederum führt dazu, dass vor einer Betriebseröffnung entstandene Betriebsausgaben gewerbesteuerrechtlich unbeachtlich sind (BFH-Urteil vom 30.8.2022, X R 17/21). Dem genannten BFH-Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger pachtete ab dem 1.12.2017 einen Imbissbetrieb einschließlich Inventar von der bisherigen Betreiberin an. Im Dezember 2017 renovierte er die angepachteten Räume. Im Januar 2018 eröffnete er den Imbissbetrieb für Gäste. Im Streitjahr 2017 wies der Kläger einen Verlust von über 15.000 Euro aus. Es handelte sich um vorab entstandene Betriebsausgaben. Das Finanzamt setzte den Gewerbesteuermessbetrag 2017 auf 0 Euro fest und legte dabei einen Gewerbeertrag von 0 Euro zugrunde. Ein Betrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes sei erst ab dem Zeitpunkt der Beteiligung des Klägers am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr anzunehmen. Dies sei hier die Betriebseröffnung im Januar 2018. Die vorhergehende Renovierung stelle eine gewerbesteuerrechtlich unbeachtliche Vorbereitungshandlung dar. Die Richter des BFH sehen dies genauso. Es komme für die Gewerbesteuer nicht auf die persönliche Steuerpflicht eines Unternehmers, sondern auf die sachliche Steuerpflicht des Steuerobjekts an; diese beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Betrieb in Gang gesetzt worden ist. Gegenstand der Gewerbesteuer sei nur der auf den laufenden Betrieb entfallende, durch eigene gewerbliche Leistungen entstandene Gewinn. Der Imbissbetrieb des Klägers sei erst mit seiner Eröffnung für die Kundschaft im Januar 2018 als Steuergegenstand des Gewerbesteuerrechts anzusehen. Dies gelte auch bei einem Betriebsübergang im Ganzen.
» mehrMitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio sind auch dann nicht als außergewöhnliche Belastung abziehbar, wenn die Aufwendungen insbesondere für die Durchführung eines Funktionstrainings, etwa einer ärztlich verordneten Wassergymnastik, getätigt werden. So hat das Niedersächsische Finanzgericht mit Urteil vom 14.12.2022 (9 K 17/21) entschieden.
» mehrWer eine sozialversicherungspflichtige (Haupt-)Beschäftigung ausübt, darf nebenher noch als Minijobber tätig werden, also eine geringfügige Beschäftigung mit einem Verdienst bis zu 520 Euro monatlich ausüben. Allerdings darf es sich nur um einen einzigen Minijob handeln und dieser darf nicht bei dem Arbeitgeber ausgeübt werden, mit dem das Hauptarbeitsverhältnis besteht. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat diese Grundsätze bestätigt und entschieden, dass es nicht zulässig ist, bei demselben Arbeitgeber neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auch eine versicherungsfreie geringfügige Beschäftigung auszuüben. Die Lohnzahlungen sind daher zusammenzurechnen und unterliegen insgesamt der Sozialversicherung und der individuellen Lohnsteuer, selbst wenn die Arbeitsverhältnisse unterschiedlich ausgestaltet sind (FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 28.12.2022, 6 K 6129/20). Der Kläger arbeitete im Innendienst eines Taxiunternehmens, das Herrn A gehörte. Sein Arbeitslohn unterlag der Sozialversicherung und wurde individuell lohnbesteuert. Einige Jahre nach Aufnahme des ersten Arbeitsverhältnisses schloss er einen weiteren Arbeitsvertrag. Der Arbeitgeber war wiederum Herr A, allerdings wurde der Kläger in einem anderen Betrieb des Herrn A eingesetzt, und zwar im Innendienst eines exklusiven Fahrdienstes mit Chauffeur. Für die zweite Beschäftigung bezog er eine monatliche Bruttovergütung innerhalb der Minijob-Grenze von damals 450 Euro. Das Beschäftigungsverhältnis aufgrund des zweiten Arbeitsvertrages wurde in den Streitjahren durchgehend als Minijob über die Bundesknappschaft mit 2 Prozent pauschaler Lohnsteuer abgerechnet. Nach Ansicht des Finanzamts und nun auch des Finanzgerichts lag hingegen keine geringfügige Beschäftigung vor; denn bei den beiden Tätigkeiten handelte es sich um ein einheitliches Beschäftigungsverhältnis, so dass die Voraussetzungen der Pauschalbesteuerung, das heißt eines Minijobs, nicht vorlagen.
» mehr